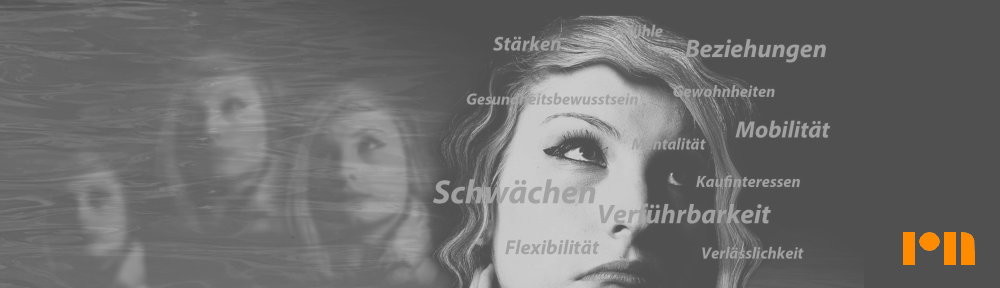Nein, es ist hier nicht die Rede von den üblichen Sauereien, mit denen das Netz bis zum Überlaufen vollgepumpt wird; ich spreche hier von einer hochoffiziellen Aktion, nämlich der digital einzureichenden Grundsteuererklärung. Obwohl die Frist bald abläuft, ist mehr als die Hälfte der angeforderteren Erklärungen noch nicht bei der Finanzverwaltung eingegangen. Und das aus guten Gründen. Der Hauptgrund dürfte sicherlich die digitale Form sein. Ich will gleich vorwegschicken: Alle, die die Erklärung noch nicht abgegeben haben, sollten sich um ein schriftliches Formular bemühen, dieses zu Hause auf dem Tisch ausbreiten (etliche Seiten!) und in Ruhe ausfüllen. Besser noch: unter den Arm klemmen und damit zum Steuerberater rennen.
Ich selber hab’s digital gemacht und kann nur sagen: ein einziger Albtraum! Ich kenne die Nachteile der digitalen Formularausfüllung, bei der man wie ein Blinder durch die Seiten geführt wird und nicht weiß, an welcher Stelle man gerade ist. Somit habe ich vorher bereits die mehr als 20-seitige Anleitung heruntergeladen, ausgedruckt und mindestens dreimal gelesen, damit im Ernstfall alles klappt. Es hat nicht geklappt! Trotz allergrößter Sorgfalt meldete die abschließende Überprüfung mehrere Fehler. Irgendetwas vergessen, irgendein Häkchen übersehen? Also die Hilfe bemüht. In reinstem, das heißt für einen Laien völlig unverständlichen Juristendeutsch brachte die „Hilfe“ am Ende null Hilfe. Ich versuchte zu verstehen, aber ich verstand – nix.
Da fiel mir ein, dass ich auf irgendeiner Seite ein Häkchenfeld offen gelassen hatte, weil ich nicht entziffern konnte, was mir der Frage gemeint war. Wie gesagt, ich bin kein Finanzexperte. Sollte dieses Häkchen wichtig sein? In der ausgedruckten Hilfe wurde die Stelle gar nicht erwähnt, also wohl nicht so wichtig? Trotzdem, einen Versuch war’s wert. Aber wo war die Stelle? Eine geschlagene Stunde irrte ich im Dschungel des Formulars herum, bis ich in etwa soviel Orientierung gewonnen hatte, um die Häkchenstelle wiederzufinden. Ich verstand den Sachverhalt immer hoch nicht, aber ich setzte das Häkchen. Erneute Überprüfung: Die vorher gemeldeten 4 oder 5 Fehler waren weg. Geschafft
Nach etwa dreieinhalb Stunden Herumirren in einem digitalen Irrgarten konnte ich den Schweiß aus dem Gesicht wischen und den Rechner ausschalten. Blieb nur noch das Fazit zu ziehen. Was hatte ich eigentlich der Finanzverwaltung mitgeteilt? Klar, Name und Anschrift. Dann das halbe Dutzend Daten, die mir die Finanzverwaltung schriftlich verraten hatte, also alles Dinge, die die Finanzverwaltung bereits wusste. Kurios: Die Finanzverwaltung teilte mir die Daten mit, die ich ihr zurückmelden musste. Nur eine einzige Angabe war neu, nämlich die bewohnte Fläche des Hauses. Eine dämliche Zahl, und dafür der ganze Aufwand!
Wenn das die Vorteile der Digitalisierung sein sollen, dann kann man sich nur die analoge Zeit zurückwünschen. „Die Digitalisierung schafft mehr Komfort, macht das Leben einfacher“, heißt es doch immer wieder. Wer daran glaubt, merkt offenbar nicht, dass die Digitalisierung ein hervorragendes Werkzeug ist, um die Menschen zu verarschen. Oder dafür zu missbrauchen, dass sie in ungeordnete Daten Ordnung hineinbringen, also Dinge tun, für die die Behörden zuständig und auch befähigt sind. Wie gesagt: digitale Verarschung bzw. eine moderne Form von bürokratischer Schweinerei.