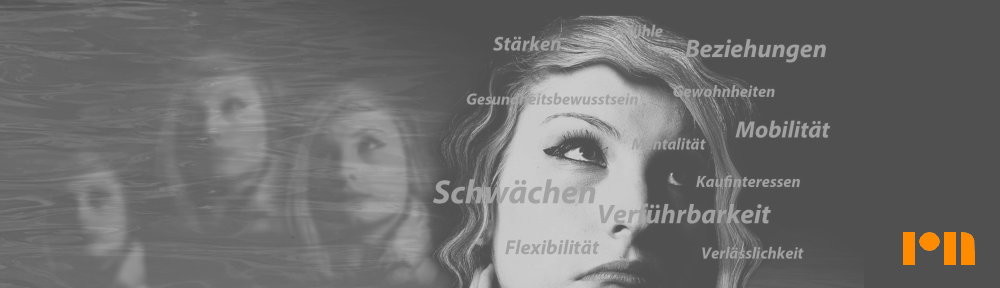Dieser letzte Beitrag zu dem Thema fällt mir nicht ganz leicht, und zwar vor allem deshalb, weil ich das englische Wort „gender“ und seine Varianten regelrecht zum Kotzen finde, ähnlich wie die Wortgruppe rund ums „date“. Widerlich. Da sind mir die Menschen, die sich – auf deutsch – zum Bumsen verabreden, doch lieber.
Gleichwohl ist es nicht verkehrt, wenn wir es sprachlich allen Geschlechtern (sorry, ich weiß nicht genau, wieviel es gibt, müssen so um die 6 oder 7 sein) recht machen wollen. Zwar kann Sprache keine gute Gesinnung erzeugen, wohl aber Ventile öffnen, so dass eine vorhandene, miese Gesinnung sich nun frei über die Gesellschaft ergießen kann. Also machen wir’s sprachlich korrekt.
Doch wie? Am besten ist es, wir besinnen uns auf den eigentlichen Kern von Sprache, nämlich das Sprachverständnis. Der Hörer (Leser usw.) soll das Mitgeteilte so auffassen, wie es vom Sprecher (Schreiber usw.) gemeint ist, und zwar mit allen denkbaren Facetten, wovon Humor und Ironie nicht die unwichtigsten sind. Wenn zum Beispiel die Rede davon ist, dass die Besucher eines Freiluftkonzerts begeistert waren, dann kommt niemand (absolut niemand) auf die Idee, es handele sich nur um männliche Besucher. Sowohl Mitteilungsabsicht als auch das Verständnis stimmen überein, womit diese schlichte, geschlechtsneutrale Form „Besucher“ die sauberste und integrativste Form der geschlechtsneutralen Sprache ist.
So einfach und schlüssig das Prinzip des neutralen Plurals auch sein mag, es gibt Leute, die damit nicht zufrieden sind. Da sind zum einen die überzüchteten Theoretiker (vorwiegend männlich), die den Unsinn des „generischen Maskulinums“ in ihr Regelwerk hineindefiniert haben. Zum anderen sind da die Sortierer (vorwiegend weiblich), die nicht damit einverstanden sind, dass alles in einen Topf geworfen wird. Also, da muss es doch was Trennendes geben, zumal ja auch die Sprache in vielen Fällen weibliche Formen anbietet! Tja, ein Privileg, das die Männer und die anderen nichtweiblichen Geschlechter nicht haben. Und wenn es die weiblichen Formen schon gibt, dann bitte auch benutzen, auf Biegen und Brechen.
Und so wurde zunächst die Doppelnennung kreiert: „Der Redner wandte sich an alle Betroffenen, an die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, an die kommunalen Beamten und Beamtinnen, an die Bürgemeister und Bürgermeisterinnen, an die Reporterinnen und Reporter, die Journalisten und Journalistinnen, an die Protokollführer und Protokollführerinnen …“ Heißa, da kann man der Redelust freien Lauf lassen. Ist natürlich bescheuert, diese Art der formalen Korrektheit, aber sprachlich kann man nichts dagegen einwenden. Wer will, soll so sprechen. Es gibt natürlich auch (wenige) Fälle, wo die sprachliche Doppelgeschlechtlichkeit einen Sinn macht. Beispiel: Der Verteidigungsminister besuchte die Soldaten und Soldatinnen in Mali. Unter „Soldaten“ versteht nicht jeder, dass auch weibliche Angehörige der Bundeswehr gemeint sind. – Nun ist diese Art der Personentrennung irgendwie auch lästig, was bei manchen Rednern zur Verschleifung führt. Beispiel Olaf Scholz: „Die Bürger und Bürgern können darauf vertrauen, dass wir …“ Ok, Sprache kann auch beschwerlich sein.
Eine andere Art, diesem verbosen Überschuss zu begegnen, besteht darin, abwechselnd mal die allgemein-neutrale und dann die rein weibliche Form zu benutzen: „Die Arbeiterinnen, Monteure, Außendienstmitarbeiter und Werkstattleiterinnen waren mit der Sitzung des Betriebsrats zufrieden“. Geht doch, wenngleich die Arbeiter und Monteurinnen zu kurz kommen. Immerhin ist gute Absicht erkennbar.
Ja, selbst wenn jemand sich auf die rein weibliche Form konzentriert, ist das – sprachlich – noch in Ordnung. Selbst inhaltlich ein bisschen. Wenn also von den Sängerinnen des Männergesangvereins „Frohe Liederfreunde“ die Rede ist, weiß doch jeder, dass es sich um männliche Sängerinnen handelt. Klarer Fall, niemand wird benachteiligt, darauf kommt es letztlich an. Und sprachlich ist es ebenfalls in Ordnung. Na ja, so einigermaßen jedenfalls. Und wir Männer haben die Chance, uns mal großzügiger als verbissene Feministinnen zu zeigen.
Es gibt also diverse Möglichkeiten, auf korrekte Weise so etwas wie sprachliche Geschlechtergerechtigkeit zu praktizieren. Nur eines geht nicht: Wir dürfen auf keinen Fall die sprachlichen Grundlagen zerstören, indem wir z.B. sprachfremde Elemente mitten in die Wörter klemmen und diese dadurch regelrecht zertrümmern. Konstrukte wie Zuschauer*innen, Mitarbeiter:innen oder Leser_innen sind sprachliche Perversitäten, und diejenigen, die sich solcher Konstrukte bedienen (vor allem mündlich) verhalten sich sprachlich pervers. Ja, pervers, im wahrsten Sinne des Wortes abartig, denn Sprache gehört nicht zu den Formen des menschlichen Miteinanders, die man beliebig umgestalten kann und darf. Ein derartiges Umbauen von Sprache ist nicht artgerecht.
Anhängerinnen und Anhänger des Gendersternchens versuchen zu bagatellisieren, indem sie darauf hinweisen, dass es immer schon Anpassungen der Sprache gegeben habe und dass die Sprache es durchaus vertrage. Doch das Gendersternchen und vor allem die artikulierte Sprechpause („Betreuer Innnen“) sind keine Anpassungen, weil sie sich nicht mit der grammatischen Grundstruktur der deutschen Sprache vertragen. Die vielen Fälle, wo das Sternchengendern zu einem widerlichen Gehampel führt, zeigen es doch überdeutlich. Diese Form des Genderns lässt sich nicht mal halbwegs sauber umsetzen und kann nur als schlimme Zerstörung von Sprache bezeichnet werden.
Das Gendersternchen oder andere, in Wörter hineingepresste Sonderzeichen stammen aus der Digitalwelt, speziell aus der Welt der algorithmischen Sprachen. Doch hier dienen solche Konstrukte nur dazu, Bezeichner (also Namen) aussagekräftig zu machen. Die Grammatik solcher Sondersprachen dagegen wird von den algorithmischen Abläufen bestimmt. Sie hat nichts mit der Grammatik einer natürlich wachsenden Umgangssprache gemein, wo die Gendersternchen nichts anderes als widerliche Fremdkörper sind.
Und auch das sage ich ganz offen: Diejenigen, die vor allem in den Medien die Gender-Sprechpause praktizieren, sind offensichtlich nicht bereit (oder fähig), ein einwandfreies Deutsch zu sprechen, und das in Zeiten, wo die Kommunikation innerhalb der Gesellschaft zunehmend verkommt. Sprache ist zu wichtig, als dass wir sie auf derart grobe Weise misshandeln dürfen. Gerade in öffentlichen Medien dürften nur solche Leute zu Worte kommen, die deutsch sprechen. Zuviel verlangt?
Bleibt noch ein persönliches Resummée: Ich fühle mich durch die Gender-Sprechpause unangenehm berührt, mitunter sogar verletzt. Wenn im TV jemand auf diese Weise gendert, schalte ich ab, egal, ob es sich um eine Nachrichtensendung oder einen Gottesdienst handelt. Bei einigen Moderatorinnen kommt der Gap so scharfkantig und verletzend heraus, dass ich die entsprechenden Sendungen gar nicht erst einschalte – sicherheitshalber. Wir recherchieren, wer die Sendung morderiert, und sollte zum Beispiel Jana Pareigis mit ihrer extrem spitzen Artikulation an der Reihe sein, dann fällt die Heute-Sendung um 19 Uhr eben aus. „Bleib sitzen und iss in Ruhe zu Ende, heute ist Pareigis dran.“
Zum Glück gibt es ja auch noch sprachlich saubere Zonen. Wenn ich mal wieder zusammenzucke, weil jemand den Gender-Schluckauf bekommt, dann greife ich zu einem Gedichtsband oder einem Buch mit gewissem literarischem Anspruch. Bei Droste-Hülshoffs Judenbuche oder Schillers Balladen ist man absolut sicher vor diesem Genderwahn. Sprachliche Geborgenheit.
Trotzdem: MIr graut vor den Leuten, die die „politische Korrektheit“ vorantreiben und damit die Abwendung von inhaltlicher Substanz und die Hinwendung zur formalen Oberflächlichkeit vorantreiben. Das ist nichts anderes als eine Aushöhlung der Gesellschaft. Wie soll eine derart schlappe, inhaltsleere Gesellschaft überleben oder gar den wachsenden Haurausforderungen stark entgegentreten? Kein Wunder, dass die Schlappen, Faulen und Entscheidungsunfähigen immer mehr auf die sogenannte „KI“ setzen. Es ist nicht nur die Sprache. die betroffen ist.